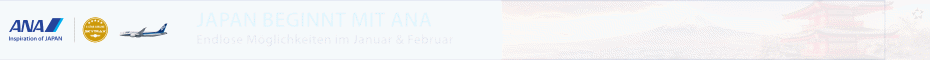Wiener Tourismusgesetz mit Hintertüre
Print-Ausgabe 7. Oktober 2016
„Damit lässt sich nichts mehr unter dem Deckmantel des Datenschutzes verbergen, die Bundeshauptstadt holt die Sharing Economy aus dem Graubereich und setzt Standards. Wien ist den anderen Bundesländern einen Schritt voraus und wird in diesem Bereich auch international zur Benchmark.“ Mit dieser fast schon enthusiastischen Stellungnahme begrüßte ÖHV-Präsidentin Michaela Reitterer die im Wiener Landtag beschlossene Novellierung des Tourismusförderungsgesetzes. Wie angekündigt werden „Diensteanbieter“ (= Online-Plattformen wie der Privatquartier-Vermittler Airbnb) dazu verpflichtet, die „Identifikationsdaten“ der bei ihnen registrierten „Unterkunftgeber“ sowie die Adressen der registrierten Unterkünfte dem zuständigen Magistrat mitzuteilen.
Steuereinnahmen aus dem Graubereich
Das klingt wie die Erfüllung des Wunschtraumes der Städte,die sich mit der Eskalation der Privatzimmervermietung über Airbnb und vergleichbaren Plattformen herumschlagen und einenWeg suchen, die in diesem Graubereich verschleierten Steuereinnahmen zu lukrieren. Verständlich, dass auch Wiens Tourismusdirektor Norbert Kettner, dessen Budget aus den Ortstaxe-Einnahmen gespeist wird, das neue Gesetz als „Weichenstellung“ für die Sicherung fairer Rahmenbedingungen für Sharing Economy und Hotellerie begrüßt.Dass Wien mit dieser Regelung zur „internationalen Benchmark“ wird, setzt allerdings voraus, dass sie auch in die Praxis umgesetzt wird – und daran darf man durchaus zweifeln.
Anläufe, Airbnb zur Herausgabe ihrer Kundendaten zu bewegen, gab es viele, gelungen ist es in keinem Fall: Die Berufung auf den Datenschutz erwies sich als verlässliches Bollwerk, auch in den USA, wo dieses Thema legerer gehandhabt wird, als bei uns. Auch in Wien gab es von Datenschutzexperten entsprechende Warnungen. Die Neos lehnten die Zustimmung zum Gesetz mit der Begründung ab, es sei ein „Schlag gegen den Datenschutz“, dass Unternehmen von einer Stadtregierung dazu verpflichtet werden, ihre Kundendaten herzugeben, dürfte in keinem Gesetz stehen.
Das könnte durch die Folgewirkung eine „Büchse der Pandora“ öffnen.Offensichtlich hat man auch bei der Formulierung des Gesetzes nicht wirklich an die Datenöffnung geglaubt: Bereits im nächsten Absatz wird eine Hintertüre in Form einer „Ermächtigung“ des Magistrats geöffnet, mit den „Diensteanbietern“ Vereinbarungen zu treffen, die es diesen erlauben, für die bei ihnen registrierten „Unterkunftsgeber“ die Ortstaxe abzuführen. Dazu wird klargestellt, dass in diesen Fällen die Haftung für die Taxe, die eigentlich vom Gast geschuldet wird, auf den „Diensteanbieter“ und den „Unterkunftsgeber“ übergeht. Zu glauben, dass es wirklich zur Offenlegung von Daten kommt, ist eher naiv. Umso mehr, als von der ressortzuständigen Wirtschaftsreferentin Renate Brauner berichtet wird, dass ihr die Varianteder Abgabe der Ortstaxe durch die Plattformen lieber wäre, als die zwangsweise Bekanntgabe der Daten.
Die Begeisterung am neuen Gesetz ist auch aus einem anderen Grund übertrieben: Die Ortstaxe ist nur ein Teil des Airbnb-Problems, und nicht einmal der wichtigste. Der durchschnittliche Nächtigungspreis in den Privatquartieren soll in Wien 69 Euro betragen, die 3,2-prozentige Ortstaxe davon wäre 2,20 Euro. Dass sie bezahlt wird, ist im Sinne der Kostengleichheit natürlich ein Schritt in die richtige Richtung, einen „Lenkungseffekt“ auf das Vermietungsgeschäft oder Chancengleichheit mit der Hotellerie kann man von diesen paar Euros nicht erwarten.
Resignation wird erkennbar
Was die Hotellerie vor allem belastet, ist der Aufwand zur Erfüllung der unzähligen Auflagen, von der Sicherheit bis zur Hygiene, die bei der „privaten“ Vermietung einfach ignoriert werden. Daran wird sich auch kaum etwas ändern: Mit der Sicherung der Ortstaxe ist das primäre Interesse der Städte gedeckt, alles andere fällt nicht in ihre Kompetenz. Und wenn jede Stellungnahme – auch jene der Hotellerie – mit der Versicherung verbunden wird, man wolle doch den Fortschritt durch neue, innovative Geschäftsmodelle nicht verhindern, dann zeigt das eher Resignation als Durchsetzungswillen. Daher wird eine entscheidende Frage erst gar nicht gestellt: Wie innovativ und förderungswürdig ist eigentlich ein Geschäftsmodell, das primär auf Steuervermeidung aufbaut und in den acht Jahren seines Bestandes zwar Milliarden an Fremdkapital verbraten, aber noch keinen einzigen Euro Gewinn ausgewiesen hat?
Günther Greul
Erstellt am: 07. Oktober 2016
Kommentar schreiben
Bitte die Netiquette einhalten. * Pflichtfelder